Ein Art Nachruf von Birgitt Morrien
Jetzt ist er tot, und ich habe das Treffen mit ihm verpasst: Fritz Roth, der Mann, der uns den Tod zurückgebracht hat. Ein Mann, der das notwendige Geschäft des Bestatters mit einer großartigen Mission zu verbinden wusste: uns den Tod wieder ins Bewusstsein zu rufen, um dem Leben entgegen dem allgegenwärtigen Diktat des Taktaktak monetärer Nutzbarmachung seine Würde zurückzugeben, seinen unbedingten Sinn.
Im Sommer las ich ein Interview mit dem an Krebs erkrankten Fritz Roth, und ich war davon so angerührt, dass ich ihm schreiben musste. „Das Leben, in seinen guten und schweren Stunden, braucht Gemeinschaft“, schrieb er zurück, die sich ihm besonders in der Verbundenheit der letzten Wochen gezeigt habe. „Lebendige Gemeinschaft hilft dabei, den Sinn in dem zu erkennen, was geschieht.“
Ein Credo in Briefen
Wir hatten uns für ein Treffen nach seiner Reise zur Seidenstraße verabredet, die sich mit meinem Bhutanaufenthalt überschnitt. Als ich zurückkam, bereitete er sich gerade auf das Gespräch mit Günther Jauch vor, das am 18. November in der ARD ausgestrahlt wurde. In seinem Brief heißt es dazu: „Und vielleicht hilft die zusätzliche Aufmerksamkeit, die meine Krankheit nun auch meiner Botschaft verschafft, ja auch bei der Erkenntnis, dass Sterben, Tod und Trauer nicht verdrängt werden dürfen, sondern mitten ins Leben gehören und kommuniziert werden dürfen.“
Konsequent hat er sein Credo gelebt. Mit Mut und besonderer Hingabe stellte er sich in den letzten Monaten seines Lebens noch einmal der Öffentlichkeit. Die ihm dort entgegengebrachte Verbundenheit „werde ich zum Anlass nehmen, die mir verbleibende Zeit zu nutzen“. Seine Überzeugung hat ihn für das Leben stark gemacht – auch und gerade im Angesicht seines bevorstehenden Todes. In dieser Haltung, unter allen Umständen dem Leben zugewandt zu bleiben, fühle ich mich durch sein Beispiel gestärkt.
Leben und Sterben in der Provinz
Einmal ist es wieder wie in meiner Kindheit auf dem Dorf. „Der Fritz“ ist bekannt und seine Todesanzeige im Stadtanzeiger trifft sicher viele. Wie damals auf dem Land: Wenn da gestorben wurde, wusste man davon. Mein Großonkel ging gleich zu jeder Beerdigung, „aus Anstand“, wie er lakonisch meinte, und weil er die Zeit dafür hatte. Insofern war der Tod bei uns zu Hause, und sowieso, weil es viele familiäre Tode zu betrauern gab.
Zwar blieb die Trauer vor allem bei uns, als Verwandte, aber sie wurde doch auch geteilt. Die Nachbarn waren da und Verwandte kamen regelmäßig zu Besuch. Was wir in diesen Zeiten erfuhren, war direkte Zuwendung, eine dem Leben zutiefst zugewandte Teilhabe, Ausdruck – zumindest in der Not – gelebter Gemeinschaft.
Die Einsamkeit der Ferntrauernden
In den urbanen Gefilden meiner erwachsenen Jahre musste ich darauf lange verzichten. Wurde da gestorben, wusste ich nicht davon. Da wurde nicht gestorben, so schien es. Wir waren jung und wurden verschont. Über Jahre teilte ich mit den meist Gleichaltrigen um mich herum die Illusion einer todesfreien Zone. Zwar wurde hier geliebt, gelacht und gelitten, doch als die Nachricht vom Tode meines Bruders in dieses mehr oder weniger geschäftige Leben einbrach, kannte ihn kaum jemand in meinem Umfeld.
Mit der Folge, dass ich nicht nur ihn vermisste, sondern auch die Möglichkeit und den Ort für eine Gemeinschaft geteilter Trauer. Ich war eine Ferntrauernde, die ihre Gefühle immerhin mit ihrer Lebensgefährtin teilen konnte, die den Bruder seit Jugendzeiten kannte. Darüber hinaus blieb ich mit meiner Trauer allein. Es war ja, in gewisser Weise, ein Phantom gestorben. Ein ihnen Unbekannter.
Die Rückkehr geteilter Trauer
In den späten Achtzigern kehrte der Tod plötzlich gleich hundertfach in unser urbanes Leben zurück. Viele Freunde starben. Darunter auch Jean-Claude, in der Szene bekannt wir ein bunter Hund. Ein Radioprofi belgischer Abstammung, der sich lokal wie international für die Rechte von Lesben und Schwulen einsetzte. Ein Charismatiker, fraglos, der seinen inneren Auftrag eloquent und überzeugend zu vermitteln wusste. Ich liebte diesen Mann, wenn man so will: auf schwesterliche Art und Weise, sehr.
Durch sein kraftvolles Auftreten verhalf er mir zu einer neuen Art des Selbstrespekts als lesbisch lebende Frau. Die Hingabe, mit der er für unser Anliegen kämpfte, beeindruckte mich. Und ich war schockiert, als ich erfuhr, er sei an Aids erkrankt, was zu dem Zeitpunkt Ende der 80er Jahre einem Todesurteil gleichkam. Doch so schlimm diese Nachricht auch für mich war, sie traf mich als Teil einer Community, mit der ich mein Entsetzen und meine Trauer darüber teilen konnte.
Das urbane Dorf
Seit 10 Jahren lebe ich in einer neuen kleinen, beinah niederländisch anmutenden Siedlung mitten in Köln. Knapp 50 Reihenhäuser stehen dort, gebaut auf stillgelegtes Werksgelände der Bahn. Zeitgleich mit zahlreichen Jungfamilien und einigen Paaren bezogen meine Frau und ich dort eines davon. Für uns die perfekte Illusion münsterländischer Lebensart im urbanen Kontext.
Ein Zuhause, ebenerdig mit Garten, aufgehoben in nachbarschaftlichem Wohlwollen, wo man sich ebenso selbstverständlich in Ruhe lässt wie einander hilft, wo es nötig ist. Auf unserer groß gefeierten Hochzeit, hat auch die Nachbarschaftscombo aufgespielt, immerhin 30 Musikerinnen und Musiker, und in der Scheune des Altenberger Hofes wurde bis in den frühen Morgen getanzt.
Todesfälle gab es zwar bisher unter uns noch keine. Wohl aber gab es Unfälle und Erkrankungen zu beklagen, teils schwere, von denen wir alle wissen. Und wenn ich sterben sollte, das habe ich mir bereits versichern lassen, werden die Nachbarn den Sarg tragen und dafür sorgen, dass ich ins Grab komme, obwohl ich aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten bin. Das nämlich war, zumindest in meiner Kinderzeit, noch ein Sakrileg und führte dazu, dass man – im Verbund mit den „Selbstmördern“ – vor die Tore des Friedhofs verbannt wurde bis in alle Ewigkeit.
Roth unter Bäumen
Abgesehen davon, dass es mir vermutlich bestimmt ist, uralt zu werden, werde ich verbrannt. Da braucht es kein Grab im klassischen Sinne. Die Asche ist in den Auen der Vechte, einem Flüsschen in einem kleinen Ort im Münsterland, unweit einer alten Mühle, zu verstreuen, das ist längst ausgemachte Sache. Dort, wo die Freifrau von Friduwi diesen Ort, Metelen, meinen Heimatort, 889 gegründet hat und wo über die Zeit von 1000 Jahren ein Damenstift bewirtschaftet wurde. Eine der letzten Äbtissinnen war die Patentante der Anna Elisabeth von Droste-Hülshoff, genannte Annette. In Gesellschaft der Seelen an diesem Ort werde ich mich sicher bis in alle Ewigkeit wohlfühlen.
Das Konzept, in der Natur die letzte Ruhe zu finden, ist von Fritz Roth maßgeblich mit weiterentwickelt und protegiert worden. Mehr noch, ein „Haus der Klage“ wird es künftig geben, mit dessen Bau noch zu seinen Lebzeiten begonnen wurde.
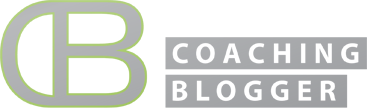
Pingback: COP - Coaching, News, Aktuell, Aktuelles, Trends, Events, Medien, Newsroom, Köln, Berlin, London