Ich mag es nicht, verlassen zu werden. Das zu vermeiden, habe ich in meinen zwanziger Jahren wohl auch deshalb geschafft, weil ich 8-mal umgezogen bin: Marburg – Boston – Münster – Bonn – Berlin – Maroldsweisach/Unterfranken – Berlin und schließlich Köln.
Dort lebe ich nun seit meinem 29. Lebensjahr, also inzwischen genau die Hälfte meines Lebens. Statt die Städte zu wechseln, nutzte ich die ersten Jahre dort für umfassende berufliche Erkundungen als Erwerbslose, Kulturreferentin, Schriftstellerin, Journalistin, PR-Beraterin, Supervisorin und schließlich als Coach.
Seit 29 Jahren bin ich liiert, also sehr beständig, was mein Beziehungsleben anbetrifft. Seit 25 Jahren arbeite ich als Coach, also ebenfalls sehr beständig. Wohl auch, weil mir der Berufszweig erlaubt, sowohl in meiner Beratungspraxis wie auch an vielen Orten weltweit mit den unterschiedlichsten Menschen zu arbeiten.
Auch meine Freundesnetze sind im Kern stabil, ab und zu jedoch geht jemand, zieht um, sei es beruflich oder aus persönlichen Gründen. Und das ist für mich immer ein großer Verlust. Je enger die Freundschaft, umso schmerzlicher, auf die Verbindung im Alltag verzichten zu müssen.
Alltag und Nachbarschaft – ein Netz, das trägt
Zwar reise ich gern, aber vor Ort, dort, wo ich lebe, liebe ich vitale Netze. Der Alltag ist mir ein hohes Gut, und vor Ort Menschen zu wissen, die ich lange kenne, die mich lange kennen, die ich liebe und schätze, das ist mir besonders wertvoll.
Erfreulicherweise gibt es auch ein dörflich anmutendes Netz von Nachbarschaft in unserer urbanen Siedlung von 46 Häusern. Entstanden auf dem Werksgelände der Bahn, zogen wir vor 15 Jahren zeitgleich alle ein.
Der Effekt: wie bei der Einschulung. Wir kennen uns mit Namen, sind im Wesentlichen alle gleich alt plus/minus 10 Jahre. Und helfen uns aus, wenn es an etwas fehlt. Treffen uns ausgewählt mal zum Kaffee oder auf ein Glas Wein.
Das geht, das darf, aber muss nicht sein. Alle durch und durch individualisiert, brauchen wir diese besondere Mischung aus Verbundenheit und Freiraum. Eine sensible Mischung, die uns aber gelungen ist zu entwickeln und zu stärken über die Jahre.
Inzwischen gehen die Kinder aus dem Haus, und viele unter uns sind mittlerweile auch als Paare mehr oder weniger allein zu Haus. Jährlich werden es mehr. Und die Idee, doch noch zurück in die Altbauwohnung zu ziehen, hat sich überlebt. Inzwischen hat es Chic, im eigenen Town House zu wohnen.
Spätestens seitdem es für die meisten von uns unbezahlbar geworden wäre, hier überhaupt zu leben. Stadtzentrumnah und doch im Grünen. Ein Traum. Hier zu bleiben fällt mir also nicht schwer. Im Gegenteil, eine schöne Aussicht.
… auch im Alter
Sollte ich sehr alt werden, gibt es hier genügend Möglichkeiten, mit dem einen Nachbarn einmal die Woche Schach zu spielen, mit der anderen Bridge und mit den Musiker_innen im Dorf endlich eine Band zu gründen. Dass ich weder Schach noch Bridge spiele, tut nichts zur Sache. Es fiel mir gerade so ein.
Damit wäre die Woche schon fast ausgefüllt, bliebe da noch das Schreiben und Fotografieren. Dafür hätte ich dann endlich mehr Zeit und könnte dieser Leidenschaft mehr Raum geben. Die Romanautorin von gegenüber treffe ich dann hin und wieder zum Tee für den inspirierenden Austausch.
Das sind alles in allem gute Aussichten. Und da ich es nicht mag, verlassen zu werden, gibt es rein statistisch für mich wenigstens diesen Trost: Allein in unserem Dorf kenne ich rund 50 Leute recht gut. Vor Ort gibt es außerdem viele Freundinnen und Freunde.
Ganz zu schweigen von den Freundschaften, die übers Land verteilt und im Ausland gelebt werden dürfen, meist virtuell. Da sind viele Herzensverbindungen, die auch über große Distanzen „funktionieren“.
„Der Luxus, zu wissen, sie sind da“, meinte eine kanadische Bekannte einmal, die selbst in Montreal lebt, ihre Liebsten aber in British Columbia. Und doch: Ich hab die Menschen gern auch bei mir vor Ort. Da ist ihr Platz. Im Alltag.
Menschen ziehen lassen (müssen)
Kein Wunder, komme ich doch aus einem anderen Jahrhundert. Vom Dorf. Und da ging es wenig mobil zu. Die Mobilität, von der ich gehörte hatte, rankte sich um Abschiede von Söhnen, die in den Krieg zogen. Und oft, das wissen wir, kamen diese nie wieder zurück.
Als ich mein Herkunftsdorf verließ, um in den USA zu studieren, legte mir mein Großvater die Hand auf. Eine starke Geste, die ich damals zwar nicht verstand, aber doch das Segensreiche darin spürte.
Er hatte durch den Krieg zwei Söhne verloren, einer, mein Onkel, vermisst mit 17; der zweite, mein Vater, starb mit 39 an den Spätfolgen schwerer Kriegsverletzungen. Weggehen ist gefährlich, hatte mein Großvater erfahren.
Zwar wusste er, als ich ging, der Krieg ist vorbei, die Enkelin geht nach Amerika. Aber dennoch rief mein Aufbruch in die Ferne Gefühle an frühere, sehr schmerzliche Verluste in ihm wach. Vielleicht empfand auch ich den Abschied darum als sehr dramatisch.
Wie bereits mein Großvater, übe auch ich mich seit inzwischen fast 30 Jahren darin, selbst zu bleiben, doch Menschen zu verabschieden, sie loszulassen, ziehen zu lassen, auch wenn ich sie sehr vermissen werde. Diese Übung hat mir geholfen zu begreifen, dass Loslassen nicht immer gefährlich ist.
Aus Abschieden lernen
Welch ein Privileg, das zu erleben: Mir liebe Menschen gehen, und wir bleiben in Verbindung. Sie leben weiter, nur an einem anderen Ort, im Herzen verbunden. Und manchmal können wir uns besuchen und bemerken, was es war, was den Freund oder die Freundin hat wegziehen lassen.
Wir nehmen sie verändert wahr und spüren mit Gewissheit, es war gut so. Die Veränderung hat ihnen gutgetan. Sie haben sich gewandelt. Wirken zufriedener, irgendwie reicher, vielleicht auch reifer. Und die Begegnung mit ihnen erscheint uns noch kostbarer.
Ich mag es nicht, verlassen zu werden, bis heute. Aber die Abschiede haben ihre Bedrohlichkeit verloren. Mit jedem Abschied neu lerne ich, loslassen hat auch was: Es wirkt erleichternd und öffnend, meinen Geist öffnend.
Wenn jetzt eine mir sehr liebe Freundin aus familiären Gründen wegzieht, zwingt mich das in sehr schöpferischer Weise dazu, es ihr in gewisser Weise gleichzutun: neuen Raum (in mir) zu erkunden, jene Leere, die sie hinterlässt, um darin für mich die Fülle meiner Möglichkeiten neu zu entdecken.
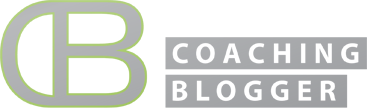
 Gone. (Foto: Morrien. New Jersey 2015)
Gone. (Foto: Morrien. New Jersey 2015)