Die Russen hatten immer Angst
In einem Interview* lese ich diese Äußerung von Swetlana Alexijewitsch, die mich sehr berührt. Im Unterschied zum Westen habe der Osten eine lange Tradition im Umgang mit der Angst erworben, meint die weißrussische Schriftstellerin. Das sei historisch bedingt.
Ob es tatsächlich so ist und ob der Westen jetzt vom Osten lernen kann, lässt das Gespräch offen. Im kriegsfernen westlichen Europa berichten die Medien unterdessen über wachsende Ängste, wachgerufen etwa von den Pariser Attentaten und der Ermordung deutscher Politiker, man sei (nun auch) hier seines Lebens nicht mehr sicher.
Denken wir jedoch an jene Bevölkerungsgruppen, die sich seit jeher und auch unter demokratischen Vorzeichen nachts nicht allein auf die Straße trauen. Und nicht in den Wald der Dämmerung. Die fürchten, auch da gefasst zu werden, wo sie zu Hause sind. Überall da, wo sie unterlegen sind, mit Übergriffen zu rechnen gelernt haben. Katzen gleich bewegen sie sich mit größter Vorsicht.
Auch diese Gruppen kennen die Angst genau, sind mit ihr vertraut und haben einen alltäglichen Umgang damit gefunden, ja, finden müssen. Das Lachen ist ihnen trotz alledem nicht vergangen. Immer mal wieder zumindest, auch, weil ihnen das Weinen alltäglich geworden ist, zumindest das, als Ventil.
Diese Erfahrungshintergründe könnten hilfreich sein, um zu verstehen, wie es gelingen kann, die Hoffnung auf ein gutes Leben nicht zu verlieren. Unter allen Umständen davon zu retten, was zu retten ist. Das zu erforschen in der Art einer Alexijewitsch, die sich vor allem als Ohr versteht, deren Feder schließlich der Kakofonie jener Stimmen Ausdruck verleiht, deren Leben und Erfahrung sonst dem Dunkel des Vergessens überlassen blieben. So ließe sich lernen von der Fülle des sonst Unerhörten, wie Leben geht, wenn die Bedrohung alltäglich geworden ist. Und mit ihr die Angst.
*DER SPIEGEL Nr. 50 / 05.12.2015
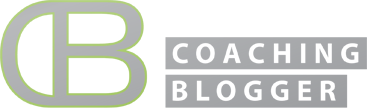
 Die Antwort einer Künstlerin auf die Zeichen der Zeit
Die Antwort einer Künstlerin auf die Zeichen der Zeit